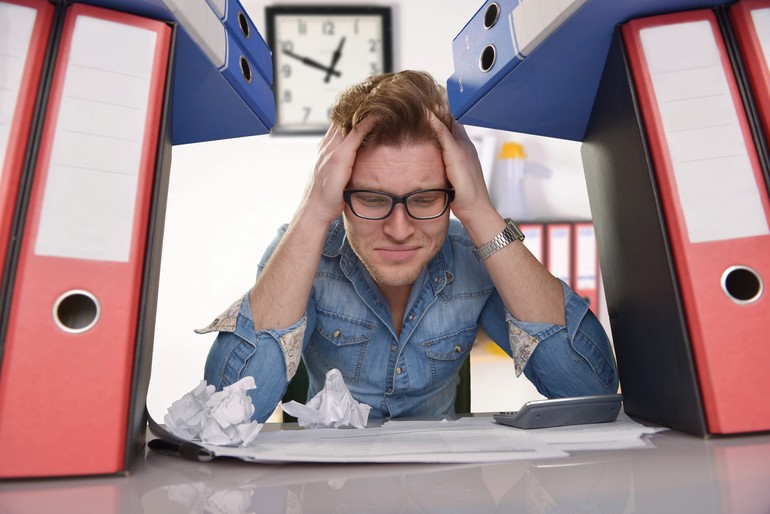Dem Burnout-Syndrom und depressiven Störungen werden zu Recht eine zunehmende Aufmerksamkeit zuteil. Handelt es sich doch um seelische Störungen von großer Häufigkeit und entsprechend herausragender gesundheitspolitischer wie volkswirtschaftlicher Bedeutung. So stehen einer Untersuchung der Betriebskrankenkassen1 zufolge bei den häufigsten Diagnosen, welche zu Arbeitsunfähigkeit führen, die Belastungsreaktionen, hinter denen sich in aller Regel das Burn-Out-Syndrom verbirgt, an 4. Stelle bei Frauen und an 5. Stelle bei Männern sowie die depressiven Störungen an 1. Stelle bei Frauen und an 3. Stelle bei Männern. An einer im letzten Jahr diagnostizierten depressiven Störung leiden in der Bundesrepublik 8 % der Frauen und 5 % der Männer.2 Allerdings sind die diagnostischen und therapeutischen Defizite erheblich. Einer Studie des Robert Koch-Institutes zufolge befinden sich lediglich 60 bis 70% aller Patienten mit depressiven Störungen überhaupt in hausärztlicher Behandlung, hiervon werden allerdings nur 30 bis 35 % als Depression erkannt und lediglich 6 bis 9 % suffizient behandelt.3 Es besteht also eine deutliche Diskrepanz zwischen der Häufigkeit der beiden Erkrankungen und der Fähigkeit des Versorgungs-systems, hierauf angemessen zu reagieren. Einer der wesentlichen Gründe hierfür dürfte die ärztliche Unkenntnis der klinischen Erscheinungen und der therapeutischen Möglichkeiten sein. Im Folgenden soll deshalb ein kurzer Überblick über das klinische Bild der Erkrankungen, die Diagnostik, ätiologische Konzepte und die therapeutischen Strategien gegeben werden.
Das Burn-Out-Syndrom wird weder in dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5TM der American Psychiatric Association noch in der Internationlaen Klassifikation psychischer Störungen ICD 10 als eigenständiges Störungsbild beschrieben, sondern wird in DSM-5TM vielmehr unter dem Rubrum „Unspecified Trauma- and Stressor-Related Disorder“ (DSM-5TM: 309.9) eingeordnet und in der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen unter „Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ (ICD 10: Z 73), aber auch bei ausgeprägteren Schweregraden unter der Störungsgruppe „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“ (ICD 10: F 43) subsummiert.
Nach Maslach4 umfasst das Burn Out-Syndrom drei Dimensionen: Die erste Dimension ist das subjektive Erleben von beruflichem Misserfolg, welches sich u.a. in einer Sinnentleerung in Bezug auf die zu erbringende Arbeitsleistung, in einem Gefühl der persönlichen Unwirksamkeit und einer kompensatorischen Hyperaktivität äußert, die zweite Dimension dann die hieraus resultierende emotionale Erschöpfung mit den Kennzeichen einer vermehrten Reizbarkeit, erhöhten inneren Anspannung und Antriebsschwäche und schließlich die dritte Dimension der Depersonalisierung, die sich als Gleichgültigkeit, zynisches Verhalten und innere Distanz zum Arbeitsumfeld zu erkennen gibt. Zur Entstehung des Burn Out-Syndroms tragen sowohl individuelle Risikofaktoren als auch Arbeitsplatzfaktoren bei. Letztere insbesondere dann, wenn die psychosozialen Anforderungen der Arbeitswelt die Bewältigungskompetenzen des Einzelnen überschreiten.5 Wenn der Arbeitsaufwand mit der Belohung durch u. a. Gratifikation und Anerkennung sowie mit dem Entscheidungsspielraum in ein Ungleichgewicht gerät, entsteht bei andauernder Überforderung das Risiko eines Burn Out-Syndroms. Dies ist gemäß dem Effort-Reward-Imbalance-Modell nach Bakker6 dann der Fall, wenn eine Dysblance besteht zwischen den Anforderungen einerseits und den Ressourcen sowie Kompetenzen andererseits. Zu den Anforderungen zählen u. a. Aufmerksamkeit und Konzentration unter Zeitdruck, emotional belastende Situationen und Verhalten, körperliche Anspannung und Belastung, zunehmende Kompexität und steigende Ansprüche, unter Ressourcen Wertschätzung und gute Beziehungen, Erfolgserlebnisse und positive Rückmeldungen, Gestaltungsmöglichkeiten, Einfluss und die Möglichkeit persönlichen Wachstums und unter Kompetenzen die Fähigkeit zum Selbstmanagement sowie Umsetzungskompetenz. Das Burn Out-Syndrom beinhaltet ein hohes Risiko für die Entwicklung anderer psychischer Störungen. Schätzungen zufolge gehen etwa 50 % der nicht adäquat behandelten Burn Out-Syndrome in depressive Störungen über.7 Nicht zuletzt deshalb ist eine sorgfältige Diagnostik erforderlich. Hierfür stehen erprobte Fragebögen wie das Copenhagen Burnout Inventory zur Verfügung.8
Depressive Störungen zeigen ein vielgestaltiges Bild. Gemäß der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD 10 zählen zu den Kernsymptomen die gedrückte, depressive Verstimmung, der Interessenverlust, Freudlosigkeit sowie Antriebslosigkeit und eine erhöhte Ermüdbarkeit. Je nach Schwere der Ausprägung können weitere Symptome hinzutreten wie eine verminderte Konzentrationsfähigkeit, eine Störung der Aufmerksamkeit, ein vermindertes Selbstwertgefühl, ein herabgesetztes Selbstvertrauen, Schlafstörungen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, pessimistische Zukunftsperspektiven, Selbstmordgedanken, Selbstverletzungen und Selbstmordhandlungen.
Nicht selten werden depressive Störungen von dem sogenannten somatischen Syndrom begleitet. Hierzu zählen die folgenden Symptome, die häufig gemeinsam auftreten: Interessenverlust oder Verlust der Freude an Aktivitäten, die üblicherweise als angenehm wahrgenommen werden, ferner eine mangelnde Fähigkeit, auf eine freundliche Umgebung oder freudige Ereignisse emotional zu reagieren, frühmorgendliches Erwachen, ein sogenanntes Morgentief, d. h. also ein ausgeprägtes Auftreten der traurigen Verstimmung in den Morgenstunden, eine psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit sowie ein deutlicher Appetitverlust im Verbund mit einem Gewichtsverlust von mehr als 5 % des Körpergewichtes im vergangenen Monat und ein deutlicher Libidoverlust.
Schwere depressive Episoden können auch begleitet sein von psychotischen Symptomen. Hier sind zu nennen Wahnideen. Deren Thema sind in der Regel Ideen der Versündigung, der Verarmung und der Überzeugung, dass in Kürze eine Katastrophe eintreten wird, für die sich der Patient verantwortlich fühlt. Zuweilen treten auch Wahrnehmungsstörungen in Gestalt von akustischen Halluzinationen auf, also Stimmen, die den Patienten mit Anklagen und Vorwürfen überziehen oder auch in Gestalt von Geruchshalluzinationen. Die Patienten berichten dann beispielsweise über den Geruch von Fäulnis oder verwesendem Fleisch. Im Rahmen des psychotischen Syndroms kann auch ein depressiver Stupor auftreten, also ein Starrezustand, in dem die Patienten sich nicht mehr bewegen, nicht mehr reden und auch nicht ansprechbar sind, obwohl ihr Bewusstsein nicht beeinträchtigt ist.
Häufig verkannt werden kognitive Störungen als Folge der Depression. Hierzu zählen Störungen der exekutiven Funktionen wie kognitive Flexibilität und Problemlösefähigkeit, Störungen des Gedächtnisses, hier vor allem eine Einschränkung der Lernfähigkeit sowie Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit, Vigilanz und Reaktionsfähigkeit. Andere kognitive Störungen sind dysfuntionale kognitive Schemata wie willkürliche Schlussfolgerungen, die Neigung zu Schwarz-Weiß-Denken, Übergeneralisierungen, die Betonung negativer und die Abwertung positiver Erfahrungen sowie die Neigung zu einem absolutistischen Denken. Diese kognitiven Störungen stellen sich der psychotherapeutischen Bearbeitung in den Weg, weshalb in jüngster Zeit gezielte psychotherapeutische Strategien wie das „Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy“ (CBASP) entwickelt wurden.
Die Quellen depressiver Störungen sind vielgestaltig. Einschneidende Lebensereignisse wie Traumata und der Verlust von Lebensgefährten können ebenso zu depressiven Störungen führen wie dauerhafte Lebensbelastungen durch chronischen Stress, Überforderung und chronische körperliche Erkrankungen. Eine Reihe von körperlichen Erkrankungen führt darüber hinaus aus organischen Gründen zu Depressionen, im einzelnen Infektionserkrankungen, Störungen der Schilddrüsenfunktion, namentlich bei einer Unterfunktion der Schilddrüse, Hirnerkrankungen, hier insbesondere Tumoren im Stirnhirnbereich, Herz-und Kreislauferkrankungen, Abhängigkeitserkrankungen und das Wochenbett. Nicht selten treten Depressionen auch auf als Nebenwirkung von Medikamenten zum Beispiel von Medikamenten zur Blutdrucksenkung. Weiterhin können Depressionen spontan, also ohne aus der Umwelt ableitbare Ursachen auftreten, wenn eine entsprechende genetische Disposition besteht. Die vielfältige Ätiologie depressiver Störungen fasst Keitner9 in dem Vulnerablititäts-Familien-Kompetenz-Modell zusammen. Hiernach besteht je nach Art der Depression eine genetische Disposition in unterschiedlichem Ausmaß, hinzu treten frühe Traumata, welche die neuronale Transmission verändern. Im weiteren Verlauf können in der Familie erlernte Kompetenzen präventiv, eine depravierende familiäre Umgebung krankheitsfördernd wirksam werden. Treten dann im späteren Lebensverlauf weitere Stressoren wie schulischer/beruflicher Misserfolg und neagtive Einflüsse der peer group hinzu, manifestiert sich die Disposition zur depressiven Störung.
Der Verlauf depressiver Störungen ist breit gefächert von stundenweise auftretenden depressiven Verstimmungen etwa bei Belastungsreaktionen bis hin zu lebenslangen depressiven Verstimmungen wie bei der Dysthymie. Genetisch disponierte Depressionen verlaufen in der Regel phasisch, das heißt, sie treten unvermittelt und ohne erkennbaren äußeren Anlass in das Leben der Betroffenen, um nach Wochen bis Monaten wieder vollständig abzuklingen, wobei sich die Phasen durchaus zu wiederholen vermögen.
Gemeinsam ist allen depressiven Störungen, dass sich die aggressive Energie gegen die Patienten selbst richtet, was sich schlimmstenfalls als Suizidhandlung manifestiert. Vice versa liegt es in der Natur depressiver Verstimmungen, dass sie nach außen gerichtetes aggressives Handeln mit Ausnahme des erweiterten Suizids in aller Regel verhüten. Das heißt, depressiv verstimmte Menschen sind üblicherweise kaum oder gar nicht in der Lage, zielgerichtet zu planen und zu handeln, was sich auch darin manifestiert, dass sie wenig bis gar nicht in der Lage sind, ihre alltägliches Leben aktiv zu gestalten oder ihren beruflichen bzw. familiären Verpflichtungen nachzukommen.
Das besondere Risiko depressiver Störungen besteht einerseits in der krankheitseigenen Suizidalität und andererseits in der erhöhten Morbidität. Darüberhinaus ist den phasisch verlaufenden Depressionen ein hohes Rückfallrisiko zueigen. Die Rezidivrate beträgt im Jahr nach dem Abklingen einer depressiven Phase 50 % bis 75 %.10 Man muß weiter davon ausgehen, dass sich 10 % bis 30 % aller Menschen mit depressiven Störungen das Leben nehmen. Schätzungen der WHO zufolge ist der Selbstmord die zweithäufigste Todesursache bei 15– bis 34-Jährigen in Europa.11 Suizidversuche treten etwa 5 bis 30 mal häufiger auf als Suizide, allerdings gibt es so gut wie keinen Suizid mit Ausnahme des Bilanz-Suizids12 ohne vorausgegegangenen Suizidversuch, weshalb auch sogenannte demonstrative Suizidversuche immer ernst zu nehmen sind. Insgesamt ist die Mortalität von Menschen mit depressiven Störungen im Lebensverlauf im Vergleich zur Normalbevölkerung um das 3,7 Fache erhöht,13 was einerseits auf die erhöhte Suizidrate, andererseits aber auch auf eine deutlich erhöhte somatische Morbidität zurückzuführen ist: Es ist davon auszugehen, dass bei etwa 30 % bis 50 % aller depressiven Patienten relevante körperliche Erkrankungen bestehen.14 Unter anderem deshalb ist die Lebenserwartung depressiver Menschen im Vergleich zur Normalbevölkerung um 10 bis 15 Jahre verkürzt.15
Zur Diagnostik stehen neben dem ärztlichen Gespräch und dem hierbei zu erhebenden psychopathologischen Befund einige bewährte Untersuchungsinstrumente zur Verfügung. Im Einzelnen zu nennen sind die Hamilton Depression Skale,16 die Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)17 und das Beck Depressions Inventar.18 Es handelt sich hierbei um hinreichend validierte Fragebögen, die eine leicht auszuwertende und rasche Auskunft über den Schweregrad der Depression erlauben. Zur Beurteilung einer möglichen Suizidalität, die immer aktiv nachzufragen ist, empfiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen: Zunächst sollte nach Suizidgedanken und wenn vorhanden nach Suizidabsichten und weiter nach konkreten Plänen sowie nach Zugangsmöglichkeiten zu suizidmethoden gefragt werden. Weiter nach Suizidalem Verhalten in der Vergangenheit aber auch nach protektiven Faktoren.
Zur genaueren Abschätzung des konkreten Risikos hat sich auch die Verwendung des Nurses Global Assessment of Suizid Risk (NGASR) sehr bewährt.19
Zur Behandlung von Burn Out und Depression hat sich eine Reihe von Therapieverfahren bewährt. Im Vordergund der Behandlung des Burn Out-Syndroms sollten psychotherapeutische Verfahren stehen, insbesonders hilfreich hat sich hierbei die Vermittlung von Techniken des Stress- und Selbstmanagement, von Achtsamkeitsübungen und gesundheitsförderlichen Aktivitäten erwiesen. Das Selbstmanagement konzentriert sich auf drei Kernfragen:20 1. Wer bin ich? Ziele der Bearbeitung hier sind die Entdeckung und Entwicklung der eigenen Identität und Persönlichkeit, der Ausbau der Kompetenzen, der Entdeckung und Entwicklung von Stärken und der Abgleich des Selbstbildes mit dem Fremdbild. 2. Was will ich? Ziel der Bearbeitung sind die Klärung eigener Werte sowie beruflicher und privater Ziele. 3. Wie erreiche ich es? Ziel ist die Entwicklung der emotionalen Intelligenz und des analytischen Denkvermögens sowie das Erlernen von Umsetzungskompetenz.
Zur Behandlung depressiver Störungen hat die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) eine nationale Versorgungsleitlinie erarbeitet.21 Diese evidenzbasierten Leitlinien empfehlen eine sorgfältige Diagnostik nach den Kriterien der ICD 10, Zusatzuntersuchungen zur Abklärung zugundeliegender oder durch die Depression kaschierter somatischer Erkrankungen und die folgenden allgemeinen Therapieprinzipien: Die Herstellung eines therapeutischen Bündnisses, die Anwendung psychoedukativer Strategien, womit die eingehende Aufklärung über die Erkrankung, die Behandlungsmöglichkeiten und Selbsthilfetechniken unter Einbeziehung der Angehörigen gemeint ist, die Vermittlung von Hoffnung und Entlastung, die Förderung von informed consent, shared decision making und damit verbunden einer guten compliance, die Entwicklung von Coping-Strategien und die Verhütung voreiliger Aktivitäten zur Veränderung der Lebenssituation. Weiterhin empfiehlt sie die Gabe von Antidepressiva, vornehmlich des SSRI-Typs und Mood Stabilizer falls erforderlich und die Durchführung einer sachgerechten Psychotherapie wobei die DGPPN-Leitlinie eine nachweisliche Wirksamkeit sowohl für die kognitive Verhaltenstherapie als auch für die psychodynamisch orientierte Psychotherapie beschreibt. Betrachtet man nun die Wirksamkeit der genannten Verfahren, so sind sowohl für kognitive als auch für psychodynamische Verfahren Ansprechraten von 67 % bis 85 %22 bzw von 70 %23 nachgewiesen. In etwa der gleichen Größenordnung von 70 % bewegen sich die Ansprechraten von Antidepressiva.24 Es ist aber zu bedenken, dass SSRI trotz ihrer besseren Verträglichkeit als herkömmliche Antidepressiva gleichwohl eine Reihe von Nebenwirkungen aufweisen wie Durchfall, Schwindel, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Übelkeit und Benommenheit in 10 bis 31 % der Einnahmen, ferner Gewichtszunahme, Schwitzen, Libidoverlust und andere sexuelle Funktionsstörungen. Selten treten Manien, Aggressionen und eine erhöhte Suizidalität auf. Weiterhin werden in Einzelfällen Absetzsyndrome beschrieben. Bei therapierfraktären Verläufen kann die Elektrokrampftherapie als Alternative25 in Betracht gezogen werden, wenngleich bei kurzfristig guter Wirksamkeit ihre langfristigen Folgen nach wie vor nicht hinreichend geklärt sind. Die Magnetstimulation befindet sich noch im Stadium der klinischen Erforschung und kann deshalb zur Routineanwendung nicht empfohlen werden.
Für depressive Störungen gilt ebenso, wie bereits für das Burn Out-Syndrom dargestellt, die Empfehlung zur Anwendung von Techniken des Stress- und Selbstmanagements, von Achtsamkeitsübungen und gesundheitsförderliche Aktivitäten wie Ausdauersport, ausgewogene Ernährung und die Substitution von Nahrungsergänzungsmitteln.26, 27
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Burn Out-Syndrom und Depressionen sehr häufige und mit hohen gesundheitlichen Risiken behaftete Erkrankungen sind, die leider ebenso häufig nicht oder zu spät erkannt werden, die aber bei einer angemessenen Behandlung eine gute Prognose haben, weshalb eine konsequente Aufklärung über die Erkrankung das Gebot der Stunde ist.
Abstrakt Abstract
Das Burnout-Syndrom und Depressionen sind häufige Erkrankungen, die leider oft nicht richtig erkannt und behandelt werden. In der vorliegenden Arbeit soll deshalb ein kurzer Überblick über das klinische Bild der Erkrankungen, die diagnostischen Möglichkeiten, die bekannten ätiologische Konzepte und die therapeutischen Strategien gegeben werden.
The Burn-Out-Syndrom and depressive disorders are frequent mental disorders, which unfortunately are ignored very often and not been treated adequately. Therefore in the present article an overview will be given about the clinical appearence, diagnostic pathways, etiological theories and about evidence-based therapeutic strategies.